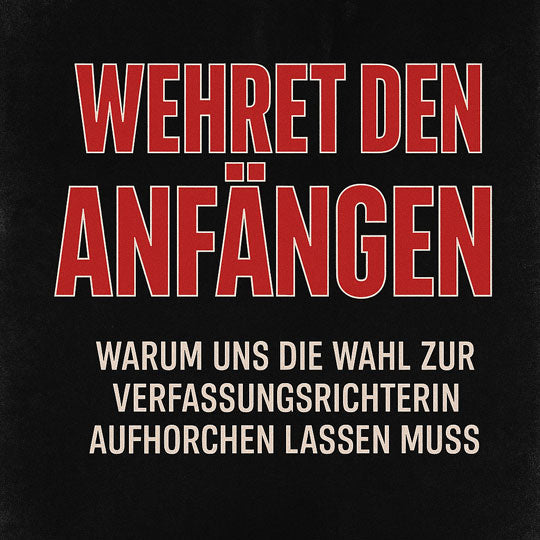Wehret den Anfängen
Hier kannst du den Artikel teilen
In einer Gesellschaft, in der ganze Milieus längst nicht mehr durch eigene Wertschöpfung leben, sondern durch Subvention, Anstellung im Staatsapparat oder NGO-Netzwerk abgesichert sind, ist der Blick auf Freiheit und Verantwortung oft vernebelt. Wer sich dem linken, oft woken Konsens nicht unterwirft, gilt schnell als dumm, rückständig oder gefährlich. Es ist diese herablassende Arroganz der Blasen, die echte Debatten verhindert – und jene diffamiert, die schlicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Dieser Text ist kein Ruf nach Rechts, sondern ein Ruf zur Vernunft.
Warum uns die Wahl zur Verfassungsrichterin aufhorchen lassen muss
Es gibt Momente, in denen politische Entscheidungen nicht nur verwundern, sondern auf tiefere Weise alarmieren. Die Nominierung der Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht ist ein solcher Moment. Nicht, weil sie juristisch unqualifiziert wäre – sondern weil sie in einer Zeit des Vertrauensverlusts all das verkörpert, was die Spaltung der Gesellschaft weiter vertieft: ideologische Starrheit, akademische Weltfremdheit und ein gefährliches Spiel mit fundamentalen Prinzipien.
Die Impfpflicht als Lackmustest für Machtmissbrauch
Brosius-Gersdorf war eine der prominentesten Stimmen, die in der Corona-Zeit mit juristischer Vehemenz für eine allgemeine Impfpflicht plädierten. Nicht aus pragmatischen, sondern aus normativen Gründen. Aus heutiger Sicht – angesichts nachlassender Wirksamkeit, unerwarteter Nebenwirkungen und gesellschaftlicher Polarisierung – war diese Forderung nicht nur ein Irrtum, sondern ein Warnsignal: Sie zeigte, wie schnell sich Juristen bereit erklären, in Ausnahmesituationen Grundrechte aufzugeben, ohne die nötige Demut vor der Tragweite ihrer Empfehlungen.
Wer heute noch stolz zu dieser Haltung steht, ohne Relativierung, ohne Rückblick, ohne Lernprozess – der offenbart nicht Stärke, sondern eine dogmatische Blindheit. Und die hat am Verfassungsgericht nichts verloren.
Menschenwürde darf keine Interpretationssache sein
Doch weit gravierender ist eine Aussage von Brosius-Gersdorf zur Debatte um Schwangerschaftsabbrüche:
„Nur weil etwas wie menschliches Leben aussieht, ist es noch lange kein Leben, das Menschenwürde verdient.“
Ein Satz, der vielleicht juristisch differenziert klingen soll – aber ein gefährliches Tor öffnet: Wer definiert, wann Leben „Menschenwürde verdient“? Wer entscheidet, ob äußere Merkmale ausreichen? Und was bedeutet das im Umkehrschluss für andere – für Schwerbehinderte, Alte, Geflüchtete, Obdachlose?
Die Würde des Menschen ist nicht relativ. Sie ist unteilbar. Wer sie an Bedingungen knüpft, verlässt das Fundament des Grundgesetzes – und öffnet das Tor zur Willkür.
Man muss hier nicht religiös argumentieren. Es reicht der Blick in die Geschichte und ein gesunder Argwohn gegenüber jeder Deutungshoheit über „wertvolles“ und „unwertes“ Leben.
Ein Land der Theoretiker – mit schwitzigen Händen in der Verantwortung
Die Debatte um Brosius-Gersdorf steht sinnbildlich für ein tiefer liegendes Problem: Wir werden zunehmend von Menschen regiert, die das echte Leben nur aus der Theorie kennen. Menschen, die nie Verantwortung für eine Firma, einen Lohnzettel, einen echten Konflikt getragen haben – aber sich über alle anderen erheben, weil sie Titel tragen und Panels besuchen.
Ein bekannter Journalist schrieb einmal:
„Es sind die weichen, schwitzigen Hände, die nie gearbeitet haben, die heute über Milliarden verfügen und sie leichtfertig verteilen.“
Ein Satz, der hart klingt, aber mitten ins Herz trifft. Denn es geht nicht darum, Akademiker pauschal zu verurteilen. Es geht darum, Erfahrung wieder zur Währung zu machen – und das Leben selbst zur Qualifikation.
Ein Verfassungsrichter sollte nicht nur Paragrafen verstehen, sondern Menschen, deren Leben von Urteilen geprägt wird. Er sollte nicht nur Recht sprechen können, sondern sich der Macht bewusst sein, die er ausübt. Und er sollte nicht nur aus dem Elfenbeinturm urteilen, sondern aus der Wirklichkeit heraus verstehen, was seine Entscheidungen bewirken.
Wehret den Anfängen
Es geht nicht um links oder rechts. Nicht um Abtreibung oder Impfung. Es geht um das Prinzip:
Wer Grundrechte zur Disposition stellt, verliert die moralische Autorität, sie zu schützen.
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube an den Rechtsstaat. Aber ich weiß auch: Die Demokratie wird nicht an einem Tag abgeschafft – sie wird schleichend ausgehöhlt, durch Deutungen, durch Relativierungen, durch falsche Besetzungen.
Deshalb sage ich als Bürger, als Unternehmer, als Vater – und als jemand, der das echte Leben kennt:
Nicht jede Professorin ist eine gute Richterin. Und nicht jede Haltung, die klug klingt, ist moralisch vertretbar.
Wir müssen wachsam sein. Und laut, wenn es nötig ist.
Nachtrag: Auch die Alternative birgt Sprengkraft – wenn Richter gestalten wollen
Wer nun glaubt, dass mit Ann-Katrin Kaufhold eine moderate Alternative zur ideologisch aufgeladenen Kandidatur Brosius-Gersdorfs aufgestellt wurde, der irrt. Auch Kaufhold steht exemplarisch für eine neue Richtergeneration, deren Selbstverständnis nicht in der Zurückhaltung, sondern im aktiven Eingriff in politische Prozesse liegt. Sie war Mitautorin des Klimabeschlusses des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 – ein Urteil, das Politikern faktisch die Handlungshoheit entzog und dem Gericht eine Art übergeordnete Zukunftskompetenz verlieh.
Was nach Verantwortung klingt, ist in Wahrheit ein richterlicher Übergriff auf demokratische Aushandlungsprozesse. Denn wo Gerichte Politik machen, verlieren Parlamente ihre Daseinsberechtigung. Und damit wir alle das Vertrauen in die Gestaltung durch Wahl und Beteiligung.
Kaufhold will nicht wahren, sie will wirken. Ihre Haltung ist nicht weniger durchdrungen von ideologischen Prämissen als die ihrer Mitbewerberin Brosius-Gersdorf – nur besser verpackt, technokratischer, kälter. Es ist diese kalte Ratio, die das Gericht zur Steuerzentrale einer Gesellschaft machen will, in der nicht mehr der Wille des Souveräns zählt, sondern die Deutungshoheit der Deutungswilligen.
Ein parteipolitischer Dammbruch: Zwei Kandidatinnen, eine Agenda
Dass beide zur Wahl stehenden Juristinnen von der SPD vorgeschlagen wurden, ist kein Zufall – sondern das Ergebnis eines parteipolitischen Machtkalküls. Die SPD hat früh verstanden, dass gesellschaftliche Transformation nicht durch Wählerstimmen, sondern durch Institutionen erfolgt. Was einst als „Marsch durch die Institutionen“ bezeichnet wurde, ist längst Realität geworden: In Bildung, Medien, NGOs – und nun auch im höchsten deutschen Gericht.
Die CDU? Sie stellt mit Günter Spinner einen fachlich versierten, unaufgeregten Arbeitsrichter – ein Mann der Praxis, der kaum öffentlich auftritt. Und genau darin liegt das Problem:
Er ist kein Gegengewicht zu den beiden ideologisch hochgerüsteten SPD-Kandidatinnen.
Vielmehr wirkt er wie das Feigenblatt eines Kompromisses, der kein Gleichgewicht schafft, sondern die Schlagseite kaschiert. Die Union scheint sich mit der Rolle des braven Statisten abgefunden zu haben.
Man will mitregieren, nicht widersprechen.
Doch in der Konsequenz bedeutet das: Die politische Mitte kapituliert vor dem Vormarsch des moralischen Absolutismus. Und während die SPD mit entschlossener Hand Ideologen ins Gericht trägt, hält die CDU die Tür auf – höflich, schweigend, rückgratlos.
Ein Appell: Hüter des Rechts – nicht Architekten der Zukunft
Es ist höchste Zeit, sich daran zu erinnern, was ein Verfassungsrichter eigentlich sein sollte: Ein Bewahrer, kein Baumeister. Ein Richter spricht Recht – er macht es nicht. Er schützt vor Übergriffen – er unternimmt keine. Er erkennt Prinzipien an – er dehnt sie nicht nach Belieben.
Wenn sich aber die Auswahl der Kandidaten an ideologischer Durchsetzungskraft statt an juristischer Demut orientiert, wird das Verfassungsgericht zur Bühne für politische Missionare.
Und genau das gefährdet, was es eigentlich schützen soll: Die Freiheit. Die Pluralität. Die Verhältnismäßigkeit.
Denn wenn Ideologen das Recht gestalten, bleibt es nicht mehr für alle gleich.
Zum guten Schluss
Wer heute noch sagt: „Wehret den Anfängen“, bekommt nicht selten ein müdes Lächeln entgegnet – oder den Vorwurf, zu dramatisieren. Dabei sind wir längst mittendrin. In einem Zeitalter, in dem Richter zu Aktivisten werden, in dem Medien Haltung über Objektivität stellen und in dem Menschen, die sich auf Freiheit, Verantwortung und Maß berufen, als störend empfunden werden. Die Gefahr liegt nicht in der nächsten Revolution – sie liegt in der schleichenden Selbstaufgabe unserer demokratischen Grundlagen. Und in einer Gesellschaft, die sich selbst dafür feiert, jeden zu belehren, der sich noch traut, Fragen zu stellen.